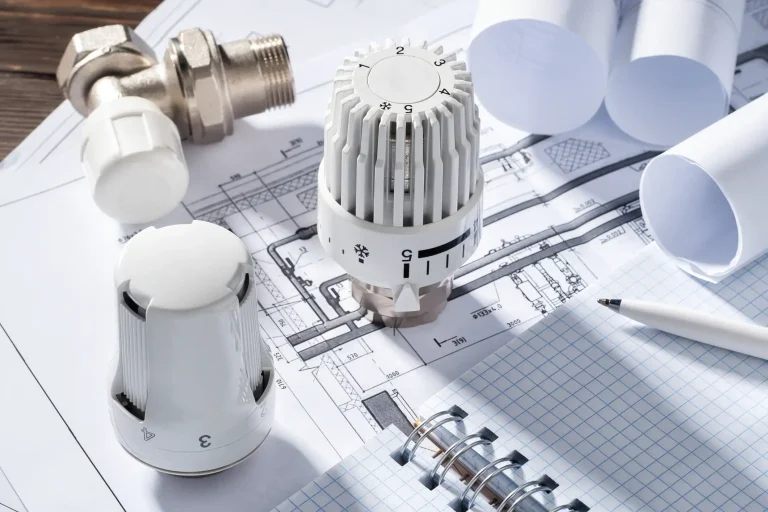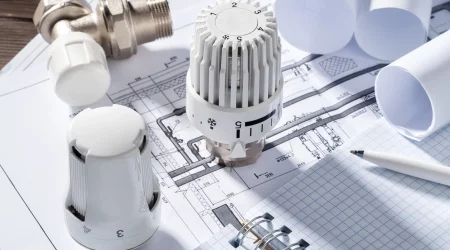Um herauszufinden, ob die Beheizung Ihres Gebäudes effizient und komfortabel ausfällt, sollten Sie die Gebäudeheizlast berechnen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Sie entweder neu bauen möchten oder eine komplette Sanierung beziehungsweise ein Austausch der gesamten Heizungsanlage ansteht. Mit einer Heizlastberechnung lässt sich herausfinden, wie viel Wärme eine Heizung bereitstellen muss, um eine konstante und angenehme Raumtemperatur sicherzustellen oder anders gesagt: Wie viel kW braucht ein Wärmeerzeuger pro Quadratmeter Wohnfläche auf der Basis des Wärmebedarfs? So verhindern Sie eine Über- oder Unterdimensionierung des Wärmeerzeugers. Dabei spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Doch was genau ist die Gebäudeheizlast, welche Methoden zur Berechnung gibt es und warum ist eine exakte Ermittlung wichtig?
- Was ist die Heizlast?
- Welche Faktoren beeinflussen die Gebäudeheizlast?
- Heizlast berechnen: Wie geht das?
- Wer führt die Heizlastberechnung durch?
- Was ist der Unterschied zwischen der Heizlastberechnung und dem tatsächlichen Energieverbrauch?
- Wie unterscheiden sich die Heizlastberechnungen für verschiedene Gebäudetypen?
- Wie wird die Heizlast bei unterschiedlichen Außentemperaturen angepasst?
- Wie können Modernisierungen oder energetische Sanierungen die Heizlast reduzieren?
- Welche Heizsysteme sind am besten für eine bestimmte Heizlast geeignet?
- Mit diesen 5 Maßnahmen halten Sie Ihre Heizkosten zusätzlich gering
- Fazit
Alles auf einen Blick:
- Eine präzise Heizlastberechnung, auch Wärmebedarfsberechnung genannt, ist entscheidend, um die richtige Heizungsgröße zu wählen und somit Energieverluste zu minimieren.
- Faktoren wie Dämmung und Luftdichtheit beeinflussen die Ermittlung des Wärmebedarfs erheblich.
- Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, abhängig von Gebäudetypen und Normen.
- Die Fenster spielen eine entscheidende Rolle bei der Heizlast.
- Modernisierungen wie eine bessere Dämmung oder der Austausch alter Fenster können die Heizlast deutlich senken und die Effizienz steigern.
Was ist die Heizlast?
Die Gebäudeheizlast beschreibt die Menge an Wärme, die ein Heizsystem liefern muss, um die gewünschte Raumtemperatur in einem Gebäude aufrechtzuerhalten, also im Prinzip die Heizleistung. Sie dient also der Ermittlung des Wärmebedarfs. Dabei wird berücksichtigt, wie viel Wärme durch die Gebäudehülle nach außen entweicht und wie viel Wärme im Inneren benötigt wird, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Die Heizlast wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und ist eine wichtige Grundlage für die Dimensionierung und Auslegung von Heizsystemen. Doch die Gebäudeheizlast ist nicht nur für die Dimensionierung des Heizsystems relevant, sondern beeinflusst auch die Wahl der Komponenten wie Heizkörper, Fußbodenheizung oder Wärmeerzeuger (zum Beispiel Wärmepumpen, Gasheizung oder Pelletheizungen.
Eine Heizlastberechnung sollte bei Neubauten, Renovierungen oder Sanierungen oder beim Austausch der Heizungsanlage erfolgen, damit die Heizungsleistung an die aktuelle Bausituation angepasst werden kann.Eine geringe Heizleistung liegt bei 1 bis 3 kW, eine mittlere bei 3 bis 10 kW (typisch für ein normal isoliertes Einfamilienhaus) und eine hohe Heizleistung bei 10 bis 25 kW.
Neben der Heizlast ist auch die Aufheizleistung zu berücksichtigen.
Warum ist die Berechnung der Heizlast wichtig?
Nur mit einer exakten Heizlastberechnung ist es möglich, die richtige Heizungsanlage auszuwählen und somit eine effiziente und ausreichende Beheizung zu gewährleisten. Eine zu kleine Anlage kann die Räume nicht ausreichend beheizen, während eine überdimensionierte Heizung ineffizient arbeitet und höhere Betriebskosten verursacht. Ein Fachbetrieb kennt sich hier aus und berät Sie entsprechend.
Welche Faktoren beeinflussen die Gebäudeheizlast?
Um die Gebäudeheizlast zu bestimmen, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Sie alle hängen mit den örtlichen Gegebenheiten des Gebäudes und dem Zustand der Fenster zusammen:
- Wärmedurchlässigkeit der Fensterrahmen und -verglasungen
- Raumhöhen, Bauweise und Nutzung der einzelnen Räume
- Dämmqualität der Gebäudehülle
- Anzahl, Größe und Ausrichtung der Fenster
- Lage und Ausrichtung des Gebäudes (zum Beispiel Himmelsrichtung, Verschattung)
- Lüftungsverluste durch geplanten Luftaustausch oder Undichtigkeiten
Welche Rolle spielen Dämmung und Wärmeverluste bei der Heizlast?
Die Dämmung eines Gebäudes ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Heizlast, da sie maßgeblich beeinflusst, wie viel Wärme im Innenraum verbleibt und wie viel über die Gebäudehülle verloren geht. Schlecht isolierte Bereiche wie Wände, Fenster oder Dächer tragen dazu bei, dass große Mengen an Wärme ungenutzt nach außen entweichen. Diese Wärmeverluste müssen vom Heizsystem kompensiert werden, was die erforderliche Heizleistung erhöht und zu höheren Heizkosten führt.
Wie beeinflussen Fensterflächen und deren Qualität die Heizlast?
Eine gute Dämmung reduziert die Transmissionswärmeverluste und ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung der Wärme im Gebäude. Dies sorgt nicht nur für eine behaglichere Innenraumtemperatur, sondern trägt auch zur Energieeffizienz bei. Ebenso beeinflusst die Qualität der Fenster (etwa Mehrfachverglasung und Rahmenmaterial) die Heizlast maßgeblich, da Fenster oft die schwächsten Punkte in der Gebäudehülle darstellen. Insbesondere Fensterflächen sind ein kritischer Punkt bei Heizlastberechnungen.
Wie wirkt sich die geografische Lage auf die Heizlast aus?
Nicht nur der Bau des Gebäudes, sondern auch der Standort wirkt sich auf die Heizlast aus. In kälteren Regionen muss die Heizlast höher angesetzt werden, während in wärmeren Gegenden die Anforderungen geringer ausfallen. Um das bei der Berechnung entsprechend einzubeziehen, werden die örtlichen Wetterdaten hinzu- und die Beschattung des Gebäudes miteinbezogen.
Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei Berechnen der Gebäudeheizlast?
Wenn ein Gebäude nicht luftdicht gebaut ist, werden Luftströmungen und damit einhergehende Wärmeverluste unkontrolliert reduziert. Das passiert, wenn zum Beispiel undichte Fenster oder Türen vorhanden sind, durch die warme Luft ungehindert durchziehen kann.

Um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen und zu verbessern, kann ein sogenannter Blower-Door-Test durchgeführt werden. Dieser Test zeigt, wo ungewollte Luftaustritte entstehen und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit erforderlich sind.
Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Heizlastberechnung?
Es gibt zwei Hauptarten von Lüftungsverlusten: die natürliche Lüftung (zum Beispiel durch Öffnen von Fenstern und Türen) und die kontrollierte, mechanische Lüftung. In beiden Fällen ersetzt kühlere Außenluft die erwärmte Innenluft, was zu einem Wärmeverlust führt, der in die Heizlastberechnung einfließt. Je höher die Luftwechselrate, desto größer sind die Lüftungswärmeverluste.
Welche Auswirkungen haben Innenraumtemperaturen auf die Heizlast des Hauses?
Je höher die gewünschte Raumtemperatur ausfallen soll, desto größer ist die Differenz zur Außentemperatur und damit steigt die Heizlast. Demnach führen unterschiedliche Raumtemperaturen in den Gebäudebereichen zu variierenden Heizlasten, was sich in der Berechnung widerspiegelt. Räume mit höherer Solltemperatur, wie Badezimmer, benötigen mehr Heizenergie als beispielsweise Schlafzimmer, die oft auf eine niedrigere Temperatur eingestellt sind. In der Heizlastberechnung wird dies berücksichtigt, um das Heizsystem optimal auf den tatsächlichen Bedarf der verschiedenen Zonen und Räume abzustimmen.
Heizlast berechnen: Wie geht das?
Die Berechnung der Heizlast durchläuft mehrere Schritte. Die Analyse der Bedingungen wie Nutzerverhalten und Dämmqualität erfolgt in der Regel im Rahmen einer Vorabschätzung, es wird üblicherweise nicht direkt gemessen, sondern auf Basis von Normwerten und Erfahrungswerten geschätzt. Zuerst werden die baulichen Gegebenheiten, das Gebäudevolumen und die Dämmqualität detailliert aufgenommen. Auf Basis dieser Informationen und den festgelegten Zielwerten für Raumtemperaturen und Nutzung werden die Transmissions- und Lüftungswärmeverluste berechnet. Die berechneten Wärmeverluste werden dann in eine Heizlast umgerechnet, um das Heizsystem genau auf den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Welche Normen und Vorschriften gibt es für die Berechnung der Heizlast?
In der Regel erfolgt die Berechnung nach DIN EN 12831-1. Dabei handelt es sich um eine europäische Norm, die detaillierte Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden, auch Neubauten, festlegt („Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast“ . Sie dient als Grundlage zur Bestimmung der erforderlichen Heizleistung, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten, indem sie bauliche, klimatische und nutzungsbezogene Faktoren einbezieht. Die DIN EN 15378-1 legt die Anforderungen für die energetische Inspektion und Bewertung von Heizungsanlagen fest. Sie dient dazu, die Energieeffizienz bestehender Systeme zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Die Norm richtet sich vor allem an bestehende Gebäude und konzentriert sich auf die Effizienzsteigerung durch Inspektion und Wartung.
Beide Normen sind für Privathaushalte relevant, wobei DIN EN 12831-1 hauptsächlich bei der Planung neuer oder der Sanierung alter Anlagen zum Einsatz kommt, während DIN EN 15378-1 auf die Effizienzbewertung und -steigerung bestehender Heizungsanlagen abzielt.
| Methode | Beschreibung | Anwendungsbereich | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|---|
| DIN EN 12831-1 | standardisierte Berechnung der Heizlast nach europäischer Norm |
|
|
|
| DIN EN 15378-1 | einfache, überschlagsähnliche Berechnung |
|
|
|
Welche Methoden zur Heizlastberechnung gibt es?
Es gibt mehrere Methoden zur Berechnung der Heizlast, die sich in ihrer Genauigkeit, Komplexität und Anwendungsweise unterscheiden. Hier sind die gängigsten Methoden:
- Normgerechte Heizlastberechnung:
Die detaillierte Berechnung nach Norm ist die in Europa standardisierte und am häufigsten angewandte Methode zur Heizlastberechnung. Sie berücksichtigt bauliche Faktoren wie Wärmedämmung und Fensterflächen, klimatische Bedingungen am Standort und nutzungsbedingte Faktoren (zum Beispiel gewünschte Raumtemperatur oder Lüftungsverluste). Diese Methode ist sehr präzise und wird insbesondere bei Neubauten und umfangreichen Sanierungen angewendet. - Vereinfachte Berechnungsmethoden:
Für grobe Abschätzungen, insbesondere in der Planungsphase oder für kleinere Projekte, gibt es vereinfachte Berechnungsmethoden. Sie bieten aber keine hohe Genauigkeit und berücksichtigen keine spezifischen Gebäudecharakteristika, wie Dämmqualität oder Luftwechselraten. - Computerunterstützte Berechnung (CAD- und BIM-Software):
Mittels moderner CAD- und BIM-Software (Building Information Modeling) können detaillierte Heizlastberechnungen durchgeführt werden. Diese Programme ermöglichen eine präzise Modellierung der Gebäudestruktur, Materialien und Standorteinflüsse und liefern hochgenaue Berechnungen, die mit Normen wie der DIN EN 12831 kompatibel sind. Diese Methode eignet sich besonders für komplexe Gebäude und wird häufig in größeren Bauprojekten angewandt. - Dynamische Simulationen:
Bei dynamischen Simulationen werden Heizlasten über einen längeren Zeitraum hinweg unter Berücksichtigung sich ändernder klimatischer und nutzungsbedingter Einflüsse berechnet. Diese Methode ist besonders präzise, da sie Tagesverläufe, Sonneneinstrahlung und andere variable Faktoren einbezieht. Sie wird häufig für sehr große Gebäude oder Spezialgebäude mit komplexem Nutzungsverhalten eingesetzt. - Tabellenbasierte oder pauschalisierte Verfahren:
In einigen Fällen werden pauschalisierte Werte oder Tabellen verwendet, die grobe Annahmen zu Heizlasten pro Gebäudetyp oder Klimazone bieten. Diese Verfahren sind wenig präzise und werden selten für genaue Planungen genutzt, eignen sich jedoch zur schnellen Abschätzung von Heizlasten.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Wahl der Methode hängt von den Anforderungen an die Genauigkeit, dem Gebäudezweck und dem Planungsstadium ab. Für Neubauten und umfangreiche Sanierungen ist die detaillierte Berechnung nach DIN EN 12831 vorgeschrieben, während vereinfachte Methoden oft nur für erste Abschätzungen genutzt werden.
Diese Werte benötigen Sie für eine genaue Heizlastberechnung
- exakte Raummaße
- Normaußentemperatur
- gewünschte Zimmertemperatur und Innentemperaturen
- Luftwärmekapazität
- U-Werte
Mit welcher Formel kann ich eine erste Heizlastberechnung durchführen?
Wenn Sie sich einen ersten Überblick über die Heizlast Ihres Gebäudes machen möchten, können Sie die einfache Berechnung nach DIN EN 15378 vornehmen, die allerdings keine offizielle Gültigkeit besitzt.
Die Formel lautet:
Sie sollten diese Berechnung aber nicht final hernehmen, um sich für einen Wärmeerzeuger zu entscheiden, sie ist lediglich ein erster Überschlag.
Möchten Sie den Transmissionswärmeverlust berechnen, dann nehmen Sie folgende Formel:
Und für Lüftungswärmeverluste gilt:
Heizlastberechnung online: Heizlastrechner
Gebäudeheizlast berechnen
Wer führt die Heizlastberechnung durch?
Eine korrekte und detaillierte Heizlastberechnung wird in der Regel von Fachleuten des Heizungs- und Sanitärhandwerks, Energieberatern oder Fachplanern für Gebäudetechnik (TGA-Planer) durchgeführt. Im Gegensatz zu einem Laien haben diese Experten die nötigen Kenntnisse und Werkzeuge, um die Berechnung fachgerecht vorzunehmen und alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen. Eine normgerechte Heizlastberechnung umfasst detaillierte Daten zur Gebäudehülle, Dämmqualität, Fensterflächen, Lüftungsanforderungen und Raumhöhen sowie den gewünschten Innenraumtemperaturen und Standortbedingungen.
Im Detail können folgende Fachleute eine Heizlastberechnung durchführen:
- Heizungsinstallateure und Fachbetriebe: Heizungsinstallateure und Heizungsbauer bieten oft die Heizlastberechnung als Teil der Planung und Dimensionierung einer Heizungsanlage an, insbesondere im Zuge eines Neubaus oder einer energetischen Sanierung.
- Energieberater: Energieberater, die oft auch in staatlich geförderte Sanierungsprogramme eingebunden sind, führen Heizlastberechnungen durch, um effiziente Heizsysteme zu planen und das Gebäude energetisch zu bewerten. Sie können häufig auch geeignete Fördermöglichkeiten aufzeigen.
- TGA-Planer oder Ingenieurbüros für Gebäudetechnik: Bei komplexeren Projekten oder größeren Gebäuden wie Mehrfamilienhäusern oder Bürogebäuden sind TGA-Planer oder spezialisierte Ingenieurbüros oft die beste Wahl. Sie berechnen die Heizlast detailliert und entwickeln umfassende Konzepte für die Heizungs- und Gebäudetechnik.
Eine Heizlastberechnung sollte immer von einem Profi durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Heizsystem korrekt dimensioniert ist und optimal arbeitet.
Was ist der Unterschied zwischen der Heizlastberechnung und dem tatsächlichen Energieverbrauch?
Die Heizlastberechnung verrät Ihnen, wie viel Wärme theoretisch benötigt wird, um ein Gebäude konstant auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie berücksichtigt dabei entsprechende Einflussfaktoren wie Wärmeverluste über die Gebäudehülle, die Außentemperatur und die gewünschte Raumtemperatur. Die Heizlast beschreibt also die maximal benötigte Heizleistung, um auch bei extremen Wetterbedingungen eine stabile Innentemperatur zu gewährleisten.
Bei dem tatsächlichen Energieverbrauch handelt es sich allerdings um eine Angabe, die sich an dem Verhalten der Bewohner, der Nutzung der Räume und den individuellen Wärmegewohnheiten orientiert. Dazu zählen weiterhin Schwankungen der Außentemperatur und nicht kalkulierbare Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung, die sich direkt auf den Verbrauch auswirken.
Wie unterscheiden sich die Heizlastberechnungen für verschiedene Gebäudetypen?
Je nach Gebäudetyp fallen unterschiedliche Bauweisen, Nutzungsarten und Anforderungen ins Gewicht, die bei der Berechnung individuell berücksichtigt werden müssen. So haben beispielsweise Gewerbegebäude oft größere Fensterflächen und offenere Räume als Wohnhäuser, die bei der Berechnung gesondert berücksichtigt werden müssen.
- Bei Wohngebäuden liegt der Fokus auf der Berechnung der Heizlast für individuell genutzte Räume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad. Hier werden die jeweiligen Raumtemperaturen, die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) und typische Lüftungsgewohnheiten berücksichtigt. Wohngebäude haben oft unterschiedliche Raumtemperaturen, was die Berechnung für jeden Raum einzeln erforderlich macht.
- Gewerbe- und Bürogebäude benötigen meist eine gleichmäßige Temperatur über größere Flächen hinweg, was eine zentralere und vereinfachte Berechnung ermöglicht. Die Heizlastberechnung muss jedoch Faktoren wie hohe Personenanzahl, Beleuchtung, IT-Ausstattung und Maschinen berücksichtigen, die zusätzliche Wärmequellen darstellen und die Heizlast reduzieren können. Auch sind oft spezielle Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnungssystemen integriert.
- Industriegebäude: Bei Industriegebäuden sind die Anforderungen an die Heizlast sehr spezifisch, da hier oft hohe Hallen, große offene Flächen und unterschiedliche Wärmequellen (Maschinen, Produktionsprozesse) vorliegen. Es wird verstärkt auf die Zonierung der Heizlast geachtet, da verschiedene Bereiche des Gebäudes unterschiedliche Anforderungen an Temperatur und Lüftung haben. Hier werden oft separate Heizsysteme für einzelne Zonen verwendet.
- Öffentliche Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser stellen hohe Anforderungen an die gleichmäßige Beheizung und Belüftung, da sie für die Sicherheit und den Komfort vieler Menschen sorgen müssen. Die Heizlastberechnung umfasst oft große gemeinschaftlich genutzte Räume wie Klassenräume, Flure, Aufenthaltsräume oder Operationssäle. Hier ist die Luftqualität und -dichtheit besonders wichtig, und es kommen häufig kombinierte Heiz- und Lüftungssysteme mit spezifischen Anforderungen zum Einsatz.
- Bei Passivhäusern und Niedrigenergiegebäuden geht es vor allem um minimale Wärmeverluste, weswegen die Heizlastberechnung sehr detailliert ausfällt und hochisolierte Gebäudehüllen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und geringe interne Wärmequellen berücksichtigt. Die genaue Berechnung ist entscheidend, da diese Gebäudetypen mit sehr niedrigen Heizlasten auskommen und oft keine klassischen Heizsysteme benötigen.
Da die Berechnungen sehr komplex werden können, ist hier ein Profi der richtige Ansprechpartner.
Wie wird die Heizlast bei unterschiedlichen Außentemperaturen angepasst?
Moderne Heizsysteme sind mittlerweile in der Lage, Energieverschwendung aktiv zu vermeiden. Das realisieren sie durch die dynamische Anpassung der Heizleistung, indem sogenannte witterungsgeführte Regelungen oder Außentemperaturfühler zum Einsatz kommen.
- Witterungsgeführte Regelung: Diese Regelung basiert auf einem Außentemperaturfühler, der kontinuierlich die Umgebungstemperatur misst. Die Heizungssteuerung passt dann die Vorlauftemperatur des Heizsystems entsprechend an. Sinkt die Außentemperatur, erhöht die Regelung automatisch die Vorlauftemperatur, um den Wärmeverlust auszugleichen. Steigt die Außentemperatur, wird die Vorlauftemperatur reduziert.
- Vorlauftemperatursteuerung: Bei modernen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwertkesseln kann die Vorlauftemperatur flexibel an die Witterungsverhältnisse angepasst werden. Dadurch wird die Heizanlage nur mit der benötigten Leistung betrieben, was die Effizienz maximiert.
- Raumtemperaturregelung: Neben der witterungsgeführten Regelung kann auch die Raumtemperaturregelung eine Rolle spielen. Intelligente Thermostate passen die Heizleistung an die Raumtemperatur an, indem sie die Wärmeabgabe des Heizkörpers gezielt steuern.
Michael Engel – Dozent & Ausbilder SHK Innung München
Wie können Modernisierungen oder energetische Sanierungen die Heizlast reduzieren?
Um die Heizlast eines Gebäudes zu reduzieren, bieten sich stets Modernisierungen und energetische Sanierungen an. Für dieses Vorhaben stehen unterschiedliche Maßnahmen zur Wahl, die für sich alleine bereits positive Auswirkungen zeigen. Eine energetische Sanierung sorgt nicht nur für eine Reduzierung der Heizlast, sondern senkt auch die laufenden Heizkosten deutlich. Weniger Wärmeverluste bedeuten, dass die Heizanlage weniger arbeiten muss, um die gewünschten Raumtemperaturen zu halten. Dadurch sinkt der Energieverbrauch und folglich auch die Heizkosten. Außerdem erhöht sich durch die Sanierung der Wohnkomfort, da Kältebrücken und Zugluft minimiert werden.
Übersicht: Modernisierungen oder energetische Sanierungen und ihre Auswirkungen
| Modernisierung/ Sanierung | Ergebnis |
|---|---|
| Fassaden, Kellerdecken und Dächer: Dämmung verbessern | eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste über die Gebäudehülle |
| Fenster: Austausch durch moderne Mehrfachverglasungen mit niedrigen U-Werten | Mehrfachverglasungen senken Energieverluste |
| Wärmeerzeuger: Umstellung auf moderne Heiztechniken wie Brennwertkessel oder Wärmepumpen | gezielte Anpassung auf den tatsächlichen Bedarf |
| Fugen und Risse: abdichten | verbesserte Luftdichtheit verringert die Lüftungswärmeverluste |
Welche Heizsysteme sind am besten für eine bestimmte Heizlast geeignet?
Eine Wärmepumpe muss dieselbe Leistung erbringen wie beispielsweise eine Gas-Hybridheizung. Daher stellt sich die Frage „Wie viel kW benötigt meine Heizung?“ grundsätzlich für jedes Heizsystem auf die gleiche Weise – die Wahl des Systems ist dabei zunächst zweitrangig.
Zuerst sollten Sie die Heizlast für alle Räume und das gesamte Gebäude berechnen lassen. Auf dieser Basis kann dann entschieden werden, welches Heizsystem verwendet wird und wie es optimal an das Gebäude angepasst wird. So werden beispielsweise die Heizkörper und Heizflächen je nach vom Heizsystem bereitgestellter Vorlauftemperatur unterschiedlich dimensioniert.
| Heizsystem | Heizlast | Vorteile |
| Wärmepumpen | niedrige bis mittlere Heizlast (gut gedämmte Neubauten oder sanierte Bestandsgebäude); hier ist die korrekt dimensionierte Heizung besonders wichtig | sehr effizient, besonders in Kombination mit Flächenheizungen (niedrige Vorlauftemperaturen) |
| Gasheizung (Brennwerttechnik) | mittlere bis hohe Heizlast (Neubauten und Bestandsgebäude) | kompakt, hohe Effizienz und geringer Energieverbrauch; flexibel einsetzbar bei unterschiedlichen Heizlasten |
| Pelletheizung | mittlere bis hohe Heizlast (Bestandsgebäude mit moderater bis hoher Heizlast) | umweltfreundlich, CO₂-neutral und gute Option für ältere Gebäude mit konstantem Wärmebedarf |
| Elektroheizung beziehungsweise Keramikheizung | sehr niedrige Heizlast (gut gedämmte Gebäude oder temporäre Räume) | einfache Installation und flexibel, besonders für punktuelle Nutzung wie Infrarotheizungen |
| Fernwärme | nur geeignet für Gebäude mit Fernwärmeanschluss, bei variabler Heizlast | geringer Wartungsaufwand, oft nachhaltig durch zentrale Erzeugung aus Abwärme oder erneuerbarer Energie |

Über unseren Experten
Michael Engel arbeitet als Ausbilder und Dozent im Fachbereich Fort- und Weiterbildung der SHK Innung München. In Seminaren vermittelt der Experte der SHK Fachwissen zur Planung und Errichtung von Wärmepumpenanlagen.
Mit diesen 5 Maßnahmen halten Sie Ihre Heizkosten zusätzlich gering
- Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann die Heizkosten in die Höhe treiben, da feuchte Luft mehr Energie benötigt, um auf Temperatur gebracht zu werden. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mithilfe eines Hygrometers und nutzen Sie gegebenenfalls Luftentfeuchter in problematischen Räumen.
- Heizkörper freihalten: Stellen Sie sicher, dass Heizkörper nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden. Freistehende Heizkörper können die Wärme besser abgeben, was die Effizienz der Heizanlage steigert.
- Heizkreislauf überprüfen: Überprüfen Sie den Heizkreislauf regelmäßig auf Luftansammlungen und stellen Sie sicher, dass das Heizsystem entlüftet ist. Luft in den Heizkörpern verringert die Wärmeleistung erheblich.
- Schwachstellen durch Wärmebilder identifizieren: Lassen Sie eine thermografische Untersuchung durchführen, um potenzielle Wärmebrücken und undichte Stellen in der Gebäudehülle sichtbar zu machen. So können gezielte Verbesserungen vorgenommen werden.
- Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile nutzen: Wählen Sie Materialien, die eine hohe Wärmespeicherfähigkeit haben, um die Temperatur in den Räumen über längere Zeit konstant zu halten. Massive Wände speichern die Wärme besser und entlasten das Heizsystem.
Fazit
Die genaue Berechnung der Gebäudeheizlast ist unerlässlich, um die Heizungsanlage effizient auszulegen und Energiekosten zu senken. Dabei spielen unterschiedliche Methoden zur Berechnung sowie zahlreiche Einflussfaktoren eine Rolle. Zusätzlich müssen auch gesetzliche Vorgaben und Normen beachtet werden, die sicherstellen, dass die Heizungsanlage den aktuellen Standards in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entspricht. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung aller Aspekte ermöglicht eine optimierte Heizlast, was nicht nur die Heizkosten senkt, sondern auch zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und verbessertem Komfort im Gebäude führt. So wird das Heizsystem in der Lage sein, jederzeit eine angenehme Raumtemperatur aufrechtzuerhalten, und trägt darüber hinaus zur Werterhaltung und Energieeffizienz des Gebäudes bei.