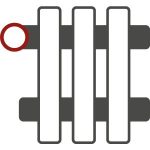Ein knisterndes Kaminfeuer hat immer einen gewissen Charme und schafft eine entspannte Atmosphäre. Vor Kauf und Installation eines Kaminofens gilt es zwei Kategorien zu unterscheiden: Wärmespeichernde Kaminöfen und direkt abstrahlende Kaminöfen. Ein Kaminofen mit Wärmespeicher hat viele Vorteile, denn er ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Heizungsbau.net erklärt Ihnen wieso.
Um besser zu verstehen, wie ein Kaminofen mit Wärmespeicher funktioniert, ist es wichtig zu wissen, worin die Unterschiede zwischen einem herkömmlichen Schwedenofen / Kaminofen und einem Speicherofen bestehen: Je nach Modell und Bauart, kann man die beiden Kaminofen-Arten äußerlich manchmal gar nicht unterscheiden. Die Speicherelemente befinden sich bei diesen Modellen hinter der Verkleidung, oberhalb der Brennkammer und sind deshalb nicht zu sehen. Bei einigen anderen Kaminöfen ist der Wärmespeicher hingegen schon von außen, anhand einer Verkleidung zu erkennen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schwedenofen / Kaminofen und einem Speicherofen?
Grundsätzlich besteht der Unterschied also nur darin, ob der Kaminofen die Wärmespeicherung gewährleisten kann, oder nicht. Hier noch einmal alle Details und Unterschiede zwischen Kaminofen/Schweden und Speicherofen im Überblick:
Kaminofen oder Schwedenofen
- Wie der Name Schwedenofen schon andeutet, kam diese Art von Kaminofen über Skandinavien zu uns. Es handelt sich dabei um einen Kaminofen ohne Wärmespeicher.
- Solange im Schwedenofen ein Feuer brennt, wird der Raum beheizt. Geht das Feuer aus, kühlt der Raum ab.
- Die Erwärmung des Raums funktioniert beim Kaminofen ohne Wärmespeicher also durch sogenannte Konvektionswärme. Konvektion ist ein Begriff aus der Physik, der erklärt wie gelöste Stoffe oder physikalischen Größen (zum Beispiel Wärme) von Trägermedien übernommen undverteilt werden. Im Fall des Schwedenofens ohne Wärmespeicher würde das beschreiben, wie die Wärmeenergie, ohne Zwischenspeicher in den Raum abgegeben wird.
- Der Kaminofen oder Schwedenofen steht frei im Raum und ist durch ein Rohr mit dem Schornstein verbunden. Er hat keinen festen Verbau. Meistens besteht diese Art von Kaminofen aus einer geschlossenen Konstruktion mit Stahlkorpus. Offene Kaminöfen sind aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr erlaubt und die früher üblichen, gusseisernen Türen wurden mittlerweile durch feuerfeste Glastüren ersetzt.
- Der Schwedenofen wird meist mit Holz beheizt (aber auch die Behebung durch Kohlenbriketts oder Ethanol ist bei manchen Modellen möglich)
Speicherofen
- Der Speicher-Kaminofen funktioniert im Prinzip wie ein Kachelofen und arbeitet mit Strahlungswärme. Die beim Heizen erzeugte Hitze, wird im Speicherofen (wie der Name schon sagt) gespeichert. Deshalb muss man nicht laufend dafür sorgen, dass ein Feuer brennt, um gleich bleibende Wärme im Raum zu gewährleisten.
- Dadurch verbraucht man im Endeffekt natürlich entsprechend weniger Brennmaterial.
- In einem Kaminofen mit Wärmespeicher wird durchschnittlich rund 30% mehr Wärmeenergie aufgefangen, als in einem Kaminofen ohne Wärmespeicher. Das beutetet, dass der Speicher-Kaminofen bis zu zehn Stunden warm bleiben kann. Die genauen Werte sind aber natürlich vom jeweiligen Modell abhängig.
- Der Wärmespeicher des Kaminofens besteht entweder aus einem massiven Verbau aus thermischer Speichermasse, oder aus einem nicht sichtbaren Speicherblock direkt über dem Brennraum. Bei diesem Speicherblock handelt es sich zumeist um Natursteine wie Speckstein, Schamottstein oderähnliche, wärmespeichernde Materialien. Abgesehen vom Material, hängt die Kapazität des Speicher-Kaminofens natürlich auch von der Größe des Speicherelements ab.
Kaminofen mit Wasserserwärmung
Eine besondere Art des Speicherofens ist der Kaminofen mit Wassererwärmung. Dieser Kaminofen besitzt zusätzlich eine sogenannte Wassertasche oder ein Wasserregister. Beim Beheizen des Ofens wird diese erhitzt und das erwärmte Wasser gelangt über Leitungsrohre in die Heizungsanlage oder kann als Warmwasser zum Abwaschen oder Duschen verwendet werden. Diese Speicheröfen, können also ebenfalls ohne ständig brennendes Feuer den Raum über lange Zeit warm halten. Zwar sind sie in der Anschaffung etwas teurer, da sie an die Heizungs- oder Warmwasseranlage angeschlossen werden müssen, jedoch arbeiten sie äußerst sparsam und schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wie lässt sich die Wärmespeicherung am Kaminofen nachrüsten?
Hat man einen Kaminofen ohne Wärmespeicher, gibt es immer noch Möglichkeiten die
Wärmespeicherung des Kamins nachträglich zu optimieren. Man kann den Wärmespeicher am Kaminofen mit Hilfe von zwei Maßnahmen nachrüsten:
Nachrüsten des Wärmespeichers durch Speichersteine
Ein Kaminofen der zur Nachrüstung durch einen Speicherblock geeinigt ist, hat oberhalb oder innerhalb der Brennkammer eigens dafür vorgesehene Halterungen. Den Speicherkern nachrüsten kann man also ganz einfach, in dem man die entsprechenden Elemente in Form von Speichersteinen hinzufügt. Diese werden zwischen der äußeren Kachelverkleidung und dem Korpus installiert. Von außen ist dieser Wärmespeicher also gar nicht sichtbar. Die Optik der Kaminöfen bleibt unverändert erhalten und die Wärmespeicherfähigkeit wird erhöht.
Je massiger, diese Speichersteine sind, umso mehr Speicherkapazität haben sie. Bei den meisten Modellen rüstet man den Speicherkern mit 55-60kg Speichermasse nach. Aber auch das hängt natürlich vom jeweiligen Modell ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
Nachrüsten des Wärmespeichers durch Wärme speichernde Ofenverkleidung
Die Speicherkapazität erhöhen können Sie außerdem, indem Sie eine Wärme speichernde Ofenverkleidung anbringen lassen, beispielsweise in Form von extern angebrachte Warmhalte-Platten. Dies bestehen aus ähnlichen Materialen wie der intern angebrachte Speicherstein. Speckstein, Schamottstein oder Granit kommen häufig zum Einsatz, um Kaminöfen mit einem Wärmespeicher nachzurüsten.