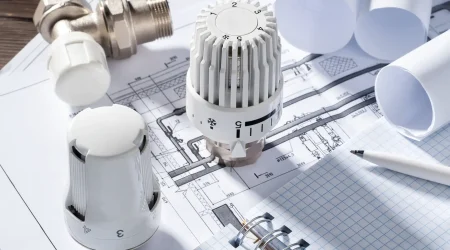Ihre Heizkörper gluckern und werden nicht mehr warm? Meistens ist es des Rätsels Lösung, die Heizungsanlage zu entlüften und wieder mit frischem Wasser zu befüllen. Doch Vorsicht: Verwenden Sie dafür kein Trinkwasser aus der Leitung! Sonst kommt es zu Schäden durch Kalk, Rost und Korrosion. Um diese Gefahr zu bannen, wurde die VDI 2035 verfasst. Sie regelt offiziell, wie Sie mit dem richtigen Heizungswasser wirksam Wärmeerzeuger, Ventile, Pumpen und Rohre in Ihrer Heizungsanlage schützen und mithilfe der Heizwasseraufbereitung einen tadellosen Betrieb gewährleisten.
Alles auf einen Blick:
- Kalk-, salz- oder säurehaltiges Heizungswasser schadet Ihrer Heizungsanlage nachhaltig. Im schlimmsten Fall ist diese nicht mehr betriebsfähig.
- Die Schäden im Heizkreislauf sind laut VDI 2035 Blatt 1 und VDI 2035 Blatt 2 auf Steinbildung und Korrosion zurückzuführen.
- Die Richtlinienreihe VDI 2035 schreibt deshalb genaue Werte für die Qualität von Heizungswasser vor, damit Ihre Heizung störungsfrei funktionieren kann.
- Entspricht Ihr Heizungswasser zu Hause diesen Werten nicht, schlägt die Richtlinie drei Verfahren zur Heizungswasseraufbereitung vor: Enthärtung, Entsalzung und pH-Wert-Stabilisation.
- Für eine Aufbereitung sollten Sie mit mindestens 150 Euro rechnen.
Schäden an Ihrer Heizung vermeiden – VDI 2035 beachten
Die VDI- Richtlinie 2035 Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen legt fest, wie Ihre Heizungsanlage und Ihr Heizungswasser für einen reibungslosen Betrieb beschaffen sein müssen.
Was beinhaltet die VDI 2035?
Die VDI 2035 behandelt dabei drei Ursachen, die die Funktion Ihrer Heizung gefährden und deshalb verhindert werden müssen. Die Richtlinie legt für jeden dieser Bereiche zum einen die schadhaften Folgen, zum anderen mögliche Lösungswege dar.
- Steinbildung:
Hier geht es nicht um echte Steine, sondern um Kalkablagerungen auf den Wärmeüberträgerflächen, zum Beispiel an den Rohren. Diese entstehen, wenn Heizungswasser mit hohem Anteil an Erdalkali-Ionen auf heiße Flächen trifft. Dadurch kommt es zu einer chemischen Reaktion, durch die sich Kalk absetzt. - Korrosion durch Wasser:
Aus der Verbindung zwischen Eisen, Wasser und Sauerstoff entsteht Rost. Dieser zersetzt metallische Materialien. Rost frisst sich regelrecht durch Ihre Heizungsrohre und sorgt dafür, dass diese nicht mehr dicht sind. Außerdem kann sich aus abgelagertem Rost auch sogenannter Schwarzschlamm bilden, der Verstopfungen der Bauteile mit sich bringt. - Korrosion durch Abgase:
Heizungsabgase beinhalten zum Beispiel Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure. Das säurehaltige Abgaskondensat greift wie Rost sämtliche Bestandteile Ihrer Heizung an. Dieser Teil der VDI wendet sich hauptsächlich an Hersteller, Planer und Fachbetriebe aus dem Heizungsbau. Eine sachgerechte Planung und Montage von Warmwasser-Heizanlagen reduziert das Risiko der abgasseitigen Korrosion auf ein Minimum.
Bis März 2019 bestand die VDI 2035 noch aus drei einzelnen Blättern. Mittlerweile behandelt Blatt 1 sowohl die Steinbildung als auch die wasserseitige Korrosion und Blatt 2 die abgasseitige Korrosion. Seit die Übergangszeit im Mai 2019 endete, gilt Blatt 3 nicht mehr.
Was ist Heizungswasser nach der VDI 2035?
Um langfristige Schäden durch Steinbildung und Korrosion zu vermeiden, muss Heizungswasser bestimmte Eigenschaften bezüglich Härte, pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit aufweisen. Eine Heizungsanlage kann nur dann optimal funktionieren, wenn das Wasser diesen Anforderungen entspricht. Ist es zu hart, verkalken die Leitungen. Ist es zu salzig, rosten die Bauteile schneller. Deshalb legt die VDI-Richtlinie genaue Werte fest.
Bei der Wasserhärte spielen zudem die technischen Daten Ihrer Heizungsanlage eine Rolle. Wie hart das Heizungswasser genau sein darf, ist abhängig von Heizleistung, Wasserfüllmenge und Heizflächengröße. Die VDI 2035 gibt eine Tabelle zur Wasserhärte vor, mit deren Hilfe Sie den individuellen Wert für Ihr Zuhause ermitteln können.
| Heizleistung in kW | Wasserhärte bei einer Kesselheizfläche von 20 l/kW | Wasserhärte bei einer Kesselheizfläche zwischen 20 l/kW und 50 l/kW | Wasserhärte bei einer Kesselheizfläche ab 50 l/kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mol/m3 | °dH | mol/m3 | °dH | mol/m3 | °dH | |
| Kleiner als 50 | < 3 | ≤ 16,8 | 2 | ≤ 11,2 | 0,02 | < 0,11 |
| Zwischen 50 und 200 | 2 | ≤ 11,2 | 1,5 | ≤ 8,4 | 0,02 | < 0,11 |
| Zwischen 200 und 600 | 1,5 | ≤ 8,4 | 0,02 | < 0,11 | 0,02 | < 0,11 |
| Ab 600 | 0,02 | < 0,11 | 0,02 | < 0,11 | 0,02 | < 0,11 |
Welches Wasser ist das richtige?
Das richtige Heizungswasser muss diesen Anforderungen entsprechen:
- Härtegrad:
Die richtige Wasserhärte für Ihre Anlage können Sie der zugehörigen Tabelle entnehmen. Sie sollten Ihre Heizungsanlage ausschließlich mit Wasser befüllen, das weich genug ist. Auch wenn das heißt, dass Sie es enthärten müssen. - Elektrische Leitfähigkeit:
Die elektrische Leitfähigkeit ist das Maß für den Salzgehalt im Wasser. Sie sollte so niedrig wie möglich sein, am besten unter 100 Mikrosiemens pro Zentimeter. Häufig ist dies nur durch eine Entsalzung des Heizungswassers zu erreichen. Ausnahme: Der Wert darf nur dann über 100 Mikrosiemens pro Zentimeter liegen, wenn die Sauerstoffkonzentration im Wasser unter 0,02 Milligramm pro Liter liegt. - pH-Wert:
Wasser mit zu niedrigem pH-Wert kann Korrosion auslösen oder beschleunigen. Deshalb muss der pH-Wert in einem nicht-schädlichen, basischen Bereich liegen zwischen 8,2 und 10,5. In diesem Bereich ist keine Kohlensäure mehr in Wasser vorhanden. Liegt der pH-Wert darunter, ist das Wasser zu sauer. Für Aluminiumwerkstoffe ist der Wert fix vorgeben, er muss ziemlich genau bei 8,5 liegen. - Sauerstoff:
Je weniger Sauerstoff im Wasser ist, umso besser. Denn der Sauerstoff ist sozusagen das Nahrungsmittel der Korrosion. Sein Anteil sollte unter 0,1 Milligramm pro Liter liegen.
Keine Kompromisse beim Heizungswasser
Damit eine moderne Heizungsanlage lange funktioniert, muss die Qualität des Füll- und Umlaufwassers passen. Die bittere Wahrheit ist, dass kalk- und salzhaltiges Rohwasser Ihre Heizung auf ganzer Ebene zerstört.
Warum ist Heizungswasseraufbereitung heutzutage sinnvoll?
Moderne Heizungsanlagen sind deutlich effizienter als ihre Vorgänger. Sie verbrauchen bei gleicher Leistung weniger Energie. Kompakte Bauteile wie Wärmetauscher und Co. garantieren durch dünnere Wandstärken und geringere Rohrdurchmesser eine möglichst verlustarme Energieübertragung. Meistens sind die Bauteile aus Edelstahl oder Aluminium und reagieren wesentlich empfindlicher auf zu hartes oder korrosives Leitungswasser als alte Geräte.
Heutzutage besitzt eine Heizungsanlage häufig einen großen Pufferspeicher. Dadurch steigt das Wasservolumen im Vergleich zur Heizfläche im Wärmetauscher des Heizkessels. Die größere Wassermenge bietet ein erhöhtes Risiko, dass sich Kalk, Rost oder Schlamm ablagern und den Wärmetauscher schädigen.
Welche Folgen hat das falsche Heizungswasser?
Heizungswasser, das nicht der VDI-Qualität entspricht, zerstört durch Steinbildung und Korrosion Ihre Heizungsanlage. Sie ist dann nicht mehr in der Lage, ihre Leistung zu erbringen:
- Bereits eine Kalkschicht von 1 Millimeter auf dem Wärmetauscher kann die Energieeffizienz um 10 Prozent reduzieren.
- Muldenkorrosion und Lochfraß greifen Pumpen stark an und machen sie unbrauchbar.
- Steinbildung führt zu Überhitzung, Spannungsrissen und Siedegeräuschen am Wärmeerzeuger.
- Kalkbeläge vermindern Rohrdurchmesser und erhöhen damit den Strömungswiderstand für das Heizwasser, das dann deutlich langsamer fließt.
- Ablagerungen verschlammen den Heizkreislauf und verstopfen Ventile.
- Korrosionsreste gelangen in den Heizkessel und richten Schäden im Inneren an.
- Zu niedrige pH-Werte lösen die Schutzschichten auf metallischen Bauteilen auf und begünstigen Korrosion.
- Die Verwendung von falschem Heizungswasser kann einen Garantieverlust von Seiten des Herstellers nach sich ziehen.
Möglichkeiten zur Heizwasseraufbereitung
Wenn Ihr Heizungswasser von der geforderten Norm abweicht, kann es Ihre Anlage dauerhaft schädigen. Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem: Sie können Ihr Leitungswasser aufbereiten oder, wie es in der Fachsprache heißt, konditionieren.
Welche Verfahren zur Heizwasseraufbereitung gibt es nach der VDI 2035?
Prinzipiell gibt es zwei Verfahren, die die VDI 2035 unterscheidet:
- Heizwasseraufbereitung: Dem Wasser werden schädigende Stoffe, zum Beispiel Härtebildner, entzogen.
- Heizwasserbehandlung: Dem Wasser werden neutralisierende Stoffe, sogenannte Korrosionsschutz-Inhibitoren, zugefügt.
Die VDI-Richtlinie sieht eine Zugabe von künstlichen Mitteln, die beispielsweise den pH-Wert verändern sollen, jedoch nur in Ausnahmefällen vor. Die populärsten Methoden sind Wasserenthärtung und Wasserentsalzung.
Wie funktioniert die Enthärtung?
Um hartes Leitungswasser zu enthärten und es von den Härtebildnern Calcium und Magnesium zu befreien, kommt ein sogenannter Ionenaustauscher zum Einsatz. Dieser entzieht dem Wasser seine Calcium- und Magnesium-Ionen beziehungsweise tauscht diese gegen Natrium-Ionen aus. Das Ergebnis ist weiches, aber nicht vollständig entsalztes Wasser. Läuft eine Heizungsanlage mit enthärtetem Wasser, spricht die VDI 2035 von salzhaltiger Fahrweise.
Wie funktioniert die Entsalzung?
Bei der Entsalzung filtert ein spezieller Mischbettionenaustauscher sämtliche Salze aus dem Wasser, zum Beispiel Chlorid, Nitrat und Sulfat. Im Mischbettionenaustauscher befinden sich Patronen, die alle gelösten Salze vollständig entfernen, auch die Härtebildner Calcium und Magnesium. Im Gegensatz zur Enthärtung besitzt vollentsalztes Wasser dann keinerlei Mineralien mehr. Daher kommt die VDI-Bezeichnung salzfreie Fahrweise.
Eine weitere Möglichkeit bietet das Verfahren der Umkehrosmose. In einer Osmoseanlage filtert eine feinporige Membran neben Bakterien oder Pestiziden auch sämtliche salzhaltigen Partikel aus dem Wasser und leitet diese ins Abwasser. Die Membran lässt ausschließlich Wassermoleküle passieren. Dadurch entsteht reines, bakterien- und kalkfreies, vollentsalztes Wasser.
Wie funktioniert die Stabilisierung des pH-Wertes?
Bei der Vollentsalzung des Heizungswassers gibt es einen negativen Nebeneffekt: Der pH-Wert kann auf ein so niedriges Niveau sinken, dass die Wasserqualität wieder abnimmt. Deshalb gibt es flüssige pH-Stabilisatoren, zum Beispiel Trinatriumphosphat, die dem Heizungswasser aus Kartuschen zugefügt werden. Dieses Verfahren heißt Alkalisierung und gehört zum Bereich der Wasserbehandlung.
Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Heizwasseraufbereitung?
Ist in der VDI 2035 die Rede von Wasseraufbereitung, ist ausschließlich die Enthärtung, die Entsalzung oder die pH-Wert-Stabilisierung gemeint. Wenn Sie Ihre Heizung bereits mit ungeeignetem Wasser betrieben haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Kalk und Rost abgelagert haben. Sie können diese schädlichen Ablagerungen zwar gut aus dem Wasser herausfiltern, an der Ursache, dem schlechten Heizungswasser, ändern Sie dadurch jedoch nichts. Es wird sich neuer Dreck bilden, den Sie wieder herausfiltern müssen. Eine Filterung ist außerdem nur dann möglich, wenn sich die Schadstoffe bereits gelöst haben. Vorhandener Rost kann sich ungehindert weiter durch die Rohre fressen. Ähnlich ist es bei einem zu hohen Sauerstoffgehalt. Sie können das Rohrsystem entgasen, aber die natürliche Sauerstoffkonzentration im Leitungswasser bleibt.
Filterung und Entgasung sind zwar gute Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung. Aber anders als Maßnahmen zur Wasseraufbereitung bewirken sie keine dauerhafte Verbesserung des Heizungswassers. Deshalb finden die bloße Filterung und die Entgasung auch keine Erwähnung in der VDI-Richtlinie.
Wie funktioniert die Filterung?
Rost, Kalk oder Algen verstopfen Pumpen, Wärmetauscher und Armaturen. Dem kann ein Filter entgegenwirken. Ein geeignetes Filtergerät ist zum Beispiel der sogenannte Schlammabschneider.
Wie funktioniert die Entgasung?
Luft hat in einer Heizung nichts verloren. Sauerstoff verstärkt die Korrosion. Stickstoff blockiert die Warmwasserverteilung. Sind die Gase einmal in Ihrem Heizkreislauf, müssen sie schnell wieder raus. Am einfachsten geht dies mit einem automatische Entlüfter.
Heizung mit aufbereitetem Wasser befüllen
Früher noch selbstverständlich beim Befüllen der Heizung: Schlauch an die Trinkwasseranlage anschließen, Ventil öffnen und die Anlage so lange befüllen, bis der Druck wieder hoch genug ist. Jetzt ist das nicht mehr so einfach. Denn Sie dürfen Ihre Heizungsanlage nur mit Wasser befüllen, dass der VDI 2035 entspricht, zum Beispiel mit enthärtetem Wasser.
Wie können Sie Heizungswasser auffüllen?
Jede Art der Wasseraufbereitung funktioniert etwas anders. Gemeinsam haben diese jedoch, dass das jeweilige Aufbereitungsgerät zwischen dem Trinkwasser-Anschluss und dem Heizungs-Füllanschluss eingesetzt wird. Normalerweise hat das Enthärtungs- oder Entsalzungsgerät zu diesem Zweck zwei Schlauchanschlüsse. Das zu harte Trinkwasser läuft durch das Aufbereitungsgerät und fließt enthärtet oder entsalzt weiter in die Heizungsanlage.
Die vorgegebene Füllmenge können Sei mithilfe eines zwischengeschalteten Wasserzählers kontrollieren. Bei der Befüllung mit entsalztem oder enthärtetem Wasser sollten Sie beziehungsweise der Heizungsfachmann sich an die Herstellervorgaben von Heizung und Aufbereitungsgerät halten.
Vor der Befüllung der Anlage sollte diese idealerweise mit einem geeignetem Reiniger gespült werden. Hier darf jedoch nur der Fachmann ran.
Kosten für die Heizungswasseraufbereitung
Die Kosten für die Aufbereitung von Heizungswasser variieren leicht. Je nachdem, für welche Variante Sie sich entscheiden.
Was kostet Heizungswasseraufbereitung?
- Kleine Enthärtungsarmaturen auf Basis des Ionentauschers gibt es bereits für 150 Euro, für größerer Anlagen sollten Sie mit 400 bis 900 Euro rechnen.
- Ein Mischbettionentauscher als tragbares Gerät mit Durchflussmessgerät kostet Sie zwischen 200 und 450 Euro. Größere, feststehende Anlagen liegen bei etwa 900 Euro.
- Osmoseanlagen zur Entsalzung gibt es ab etwa 150 Euro. Die meisten Anlagen, die sich für Heizungen eignen, kosten um die 300 Euro. Große Anlagen mit einer höheren Leistungsfähigkeit liegen bei 900 Euro.
- Nachspeisesets für die Stabilisierung des pH-Wertes, wenn sich dieser durch die Vollentsalzung verändert hat, kosten zwischen 150 und 200 Euro. Kombinierte Anlagen, also Entsalzung inklusive Nachspeisung kosten mindestens 500 Euro.
- Ein Schlammabschneider, der das Leitungswasser nicht nachhaltig reinigt, sondern nur Ablagerungen herausfiltert, kostet circa 100 Euro.
- Automatische Entlüfter liegen preislich zwischen 10 und 50 Euro.
Fazit
Die Richtlinienreihe VDI 2035 dient dem Schutz Ihrer Heizanlage. Ausgehend von den möglichen Schäden durch ungeeignetes Heizwasser ist der Leitfaden in zwei Blätter unterteilt. VDI 2035 Blatt 1 beschäftigt sich mit der Steinbildung und der wasserseitigen Korrosion, VDI 2035 Blatt 2 mit der abgasseitigen Korrosion. Während letztere sich hauptsächlich an Heizungshersteller und -bauer richtet, hilft Blatt 1 auch Ihnen weiter. Sie erfahren, was Kalk und Rost Ihrer Heizung antun können und wie Sie verhindern, dass Ihnen die Heizung deshalb ausfällt.
Dazu macht die VDI klare Vorgaben: Das Heizwasser sollte eine elektrische Leitfähigkeit unter 100 Mikrosiemens pro Zentimeter, einen pH-Wert zwischen 8,2 und 10,5 sowie einen Sauerstoffgehalt unter 0,1 Milligramm pro Liter aufweisen. Außerdem sollte es weich genug sein. Ihren individuellen Wert können Sie der Tabelle zur Wasserhärte entnehmen, die die technischen Daten Ihrer Heizung miteinbezieht.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie etwas nachhelfen müssen, um diese optimalen Werte zu erreichen. Dazu haben Sie verschiedenen Möglichkeiten zur Heizungswasseraufbereitung: Enthärtung, Entsalzung und pH-Wert-Stabilisation. Durch die Aufbereitung schützen Sie Ihren Heizkreislauf dauerhaft. Manche Geräte sind bereits ab 150 Euro erhältlich.